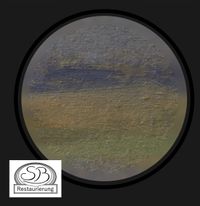2025-04-03
Welche Farben verwendeten die Künstler*innen um 1900 und wie individuell war ihr Einsatz? Eine wertvolle Quelle bietet die bereits angesprochene Künstlerbefragung des Schlesischen Museums der bildenden Künste in Breslau. In dieser Umfrage wurden 105 Künstler*innen nach den Maltechniken befragt, die sie für 138 ihrer Kunstwerke verwendet haben. Alle Kunstwerke befanden sich im Besitz des Breslauer Museums. Die ältesten Dokumente sind Briefe aus dem Jahr 1899. Ab 1912 verschickte das Schlesische Museum der bildenden Künste einen standardisierten Fragebogen zur Maltechnik, der in den darauf folgenden 25 Jahren weitgehend unverändert blieb. Die Fragen erkundigten sich nach Bildträger, Grundierung, Malschicht und Firnis, also die Bestandteile des traditionellen Gemäldeaufbaus. Die Angaben zu Öl- und Harzölfarben sind nachfolgend in vereinfachter Form zusammengefasst.
Angaben der Künstler*innen zu Öl- und Harzölfarben
In den meisten Fällen gaben die Künstler*innen an, Ölfarben oder Harzölfarben für ihre Kunstwerke verwendet zu haben. Mehrheitlich kamen handelsübliche Farben zum Einsatz, wobei die Ölfarben der Firmen Moewes und Behrendt in Berlin am häufigsten erwähnt wurden. Besonders beliebt waren die Harzölfarben Mussini der Firma Schmincke & Co. in Düsseldorf. Die Grafik zeigt, welche Firmen und wie oft sie von den Künstler*innen für Ölfarben und Harzölfarben genannt wurden. Einige Maler*innen hatten mehrere handelsübliche Farben für ein Gemälde verwendet, während andere einfach ihre üblichen Produkte aufführten. Teilweise konnten sich die Kunstschaffenden nicht mehr an konkrete Fabrikate erinnern oder notierten einfach „gewöhnliche Ölfarben“. Neben der Wahl der Fabrikate spielten auch individuelle Modifikationen eine Rolle.
Individuelle Anpassung von Produkten
Verschiedene Künstler*innen benutzten dasselbe Produkt, passten es aber durch Zusätze ihren eigenen Vorlieben an. So malte Anton von Werner sein 1895 fertiggestelltes Historienbild Kaiser Friedrich als Kronprinz auf dem Hofball 1878 mit Moewes Ölfarbe. Auch Ernst Ludwig Kirchner schrieb, dass er Moewes Ölfarbe verwendete, allerdings mit dem Zusatz einer Wachslösung. In einigen Fällen wechselten die Künstler*innen zwischen der Untermalung und der Übermalung zu einem anderen Malmittel oder sogar zu einem anderen Bindemittelsystem. Konrad von Kardorff erinnerte sich, das Bildnis des Dr. Benno Geiger im Jahr 1914 mit „Weimarfarbe“ untermalt zu haben. Er notierte die Zusammensetzung als „Feigenmilchfarbe mit einer Wachslösung und Terpentin“, was auf die Verwendung von Weimarfarbe als Tempera hinweist. Nach dem Auftragen eines mit Mohnöl vermischten Bernsteinfirnisses vollendete der Künstler das Porträt mit Ölfarben der Firmen Behrendt und Blockx. Solche individuellen Vorgehensweisen wirken sich nicht nur auf das Erscheinungsbild, sondern auch das Alterungsverhalten der Gemälde und damit auf ihre spätere Restaurierung aus.

Die Grafik zeigt alle Firmenangaben der Künstler*innen für Öl- oder Harzölfarben, die für Untermalung und Übermalung verwendet wurden, sowie die Fälle, in denen für einzelne Gemälde mehrere Produkte genannt wurden. © S. Beisiegel
Literatur:
Silke Beisiegel: Künstlerbefragung zu maltechnischen Angaben zwischen 1899 und 1938 im Schlesischen Museum der bildenden Künste zu Breslau, 2014.
Zu Kirchners Maltechnik sind einige Publikationen erschienen, z. B. Kirchner-Museum Davos, Karin Schick, Heide Skowranek (Hrsg.): „Keiner hat diese Farben wie ich”. Kirchner malt, 2011.
Die genannten Gemälde von Anton von Werner↗ und Konrad von Kardorff↗ befinden sich seit 1953 zusammen mit weiteren Gemälden aus dem Breslauer Museum in den Staatlichen Museen zu Berlin.
Silke Beisiegel - 16:32 @ Material und Technik